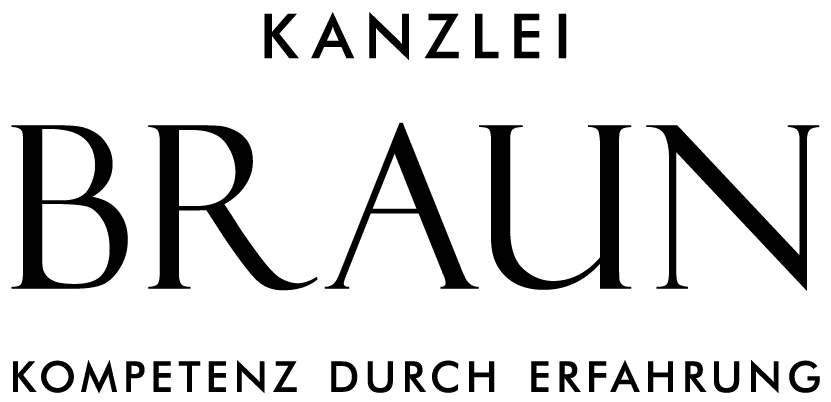Haftungsrisiken im Tierarztalltag und beim Tierkauf
Ein Pferd wechselt den Besitzer, ein Hund erhält seine Routineimpfung, ein Tierarzt greift zum Medikamentenschrank. Was wie Alltag in der Veterinärmedizin wirkt, ist in Wahrheit ein rechtliches Minenfeld. Wenn ein Tier nach einer Behandlung stirbt, ein Impfstoff Komplikationen verursacht oder ein verborgenes Gebrechen nach dem Kauf auffällt, landet der Streit schnell vor Gericht. Die Haftungsfragen sind komplex, die Rechtslage vielschichtig und die Risiken für Tierärzte und Verkäufer erheblich.
Wer nun denkt, das alles sei eine Randerscheinung, irrt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in den vergangenen Jahren strenger geworden, nicht zuletzt durch europäische Vorgaben. Und was bedeutet eigentlich ECVM? Wer dahinter ein europäisches Abkommen für Tierarzneimittel vermutet, liegt falsch. ECVM steht für Equine Cervical Vertebral Malformation, eine angeborene Missbildung der Halswirbelsäule bei Pferden. Diese Erkrankung kann bei Kaufverträgen erheblichen juristischen Sprengstoff bergen, wenn sie erst nachträglich festgestellt wird und den Wert des Pferdes erheblich mindert.
EU-Verordnung und TAMG: Strenge Regeln für Tierärzte
Den verbindlichen Rechtsrahmen für Tierarzneien liefert nicht eine „Konvention“, sondern die EU-Verordnung (EU) 2019/6 über Tierarzneimittel. Sie gilt seit 2022 unmittelbar und wird in Deutschland durch das Tierarzneimittelgesetz (TAMG) und die Tierärztliche Hausapothekenverordnung (TÄHAV) flankiert. Die Botschaft ist eindeutig: Einheitliche Standards sollen Missbrauch verhindern und Arzneimittelsicherheit gewährleisten.
Für Tierärzte bedeutet das insbesondere:
- strenge Regeln bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten,
- eine lückenlose Dokumentationspflicht aller Abgaben und Behandlungen,
- das Verbot, geldwerte Vorteile von Pharmaunternehmen anzunehmen.
Verstöße können nach den Vorschriften des TAMG und § 96 Arzneimittelgesetz strafbar sein.
Im Mittelpunkt steht die Medikamentenabgabe. Tierärzte dürfen verschreibungspflichtige Tierarzneimittel nur für Tiere abgeben, die sie selbst untersucht und diagnostiziert haben. Das ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Verordnung in Verbindung mit § 12 TAMG und § 3 TÄHAV. Rezepte anderer Tierärzte „einzulösen“ ist ebenso unzulässig wie die Abgabe ohne vorherige Untersuchung. Versandhandel? Verboten. Selbst ein vermeintlicher Gefallen kann schnell zu einem Verstoß führen, der mit Bußgeldern und im Extremfall mit strafrechtlichen Konsequenzen geahndet wird.
Behandlungsfehler und ihre weitreichenden Folgen
Doch auch über die Arzneiabgabe hinaus drohen Haftungsrisiken. Ein Kernbereich sind Behandlungsfehler. Zwischen Tierhalter und Tierarzt besteht in der Regel ein Dienstvertrag im Sinne von § 611 BGB, der keine Heilung, wohl aber die fachgerechte Behandlung schuldet. Die Behandlung muss nach den anerkannten Regeln der Tiermedizin erfolgen, also lege artis. Fehlerhafte Diagnosen, falsche Dosierungen oder unterlassene Befunderhebungen können eine Pflichtverletzung darstellen. Bei Schadenseintritt greifen die Vorschriften der §§ 280, 823 BGB für Schadensersatzansprüche.
Der Tierhalter muss den Fehler und die Ursächlichkeit nachweisen. Gelingt ihm das, muss der Tierarzt beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Liegt ein grober Behandlungsfehler vor, kehrt sich die Beweislast um. Fehlende Dokumentation wirkt ebenfalls zu Lasten des Tierarztes. Schmerzensgeld für das Tier? Nicht vorgesehen. Nach § 90a BGB sind Tiere keine Sachen, werden aber haftungsrechtlich wie Sachen behandelt. Ersatzfähig sind also der objektive Wert des Tieres und Folgekosten wie weitere Behandlungen.
Tierkaufverträge: Wenn ein Mangel zur Haftungsfalle wird
Und die Verkäufer? Beim Tierkauf gelten die Regeln der §§ 433 ff. BGB. Ein versteckter Mangel liegt vor, wenn das Tier beim Gefahrübergang krank oder genetisch vorbelastet war. Zeigt sich der Mangel innerhalb von zwölf Monaten, greift die Beweislastumkehr des § 477 BGB im Verbrauchsgüterkauf:
Es wird vermutet, dass der Mangel schon bei Übergabe vorhanden war. Eine Erkrankung wie ECVM ist ein typischer Sachmangel nach § 434 BGB, auch wenn sie zunächst symptomlos bleibt. Der Käufer kann nach § 437 BGB Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz verlangen. Für den Verkäufer ist Arglist fatal, denn bei vorsätzlichem Verschweigen (§ 444 BGB) sind Haftungsausschlüsse unwirksam. Wer bewusst täuscht, riskiert außerdem eine Strafbarkeit wegen Betrugs (§ 263 StGB).
Wenn Gutachten zum Streitpunkt werden
Eine besondere Rolle spielt der Tierarzt bei Ankaufsuntersuchungen. Sie gelten als Werkverträge im Sinne der §§ 631 ff. BGB. Der Tierarzt schuldet ein zutreffendes und vollständiges Gutachten über den Gesundheitszustand des Tieres. Werden relevante Untersuchungen unterlassen oder Befunde falsch bewertet, haftet er für den daraus entstehenden Schaden. Auch Käufer, die selbst nicht Vertragspartner waren, können Ansprüche haben, wenn der Vertrag Schutzwirkung für Dritte entfaltet. Die Rechtsprechung des BGH erkennt dies regelmäßig an.
Impfschäden: Selten, aber juristisch brisant
Ein weiteres sensibles Thema sind Impfschäden. Jede Impfung birgt ein Restrisiko, das den Tierarzt nicht automatisch haftbar macht. Voraussetzung für eine Haftung ist ein Fehler – etwa das Impfen eines kranken Tieres, die Verwendung eines abgelaufenen Impfstoffes oder unsachgemäße Lagerung. Hier greifen die Regeln über Behandlungsfehler (§ 280 BGB). Kommt der Schaden vom Impfstoff selbst, haftet der Hersteller nach dem Produkthaftungsgesetz (§ 1 ProdHaftG). Bereits in der Entscheidung des BGH zur sogenannten Hühnerpest aus dem Jahr 1969 wurde die Haftung des Herstellers für verunreinigte Impfstoffe anerkannt. Ein staatlicher Entschädigungsfonds wie beim Menschen existiert nicht, das Risiko einer seltenen Impfreaktion trägt der Halter.
Fazit: Wo Routine endet, beginnt das Risiko
Was bleibt? Wer in diesem Feld arbeitet, muss die Rechtslage kennen. Für Tierärzte bedeutet die Einhaltung der Vorgaben des TAMG und der TÄHAV, sorgfältige Dokumentation und Aufklärungspflichten, gestützt auf die Grundsätze der §§ 611, 280 BGB. Für Verkäufer bedeutet es, Mängel nicht zu verschweigen, um nicht in die Haftungsfalle zu geraten.
Die Linie zwischen Routine und Risiko ist dünn, und wer sie ignoriert, riskiert nicht nur zivilrechtliche Ansprüche, sondern auch berufsrechtliche Konsequenzen und im Extremfall strafrechtliche Ermittlungen. Sicher ist nur eines: In der modernen Tiermedizin endet die Verantwortung nicht an der Praxistür oder am Stall, sie beginnt beim Gesetz. Und wer sich daran nicht hält, setzt nicht weniger als seine Existenz aufs Spiel.
Wenn Sie Beratung zu Haftungsfragen im Tierarztalltag oder beim Tierkauf benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.