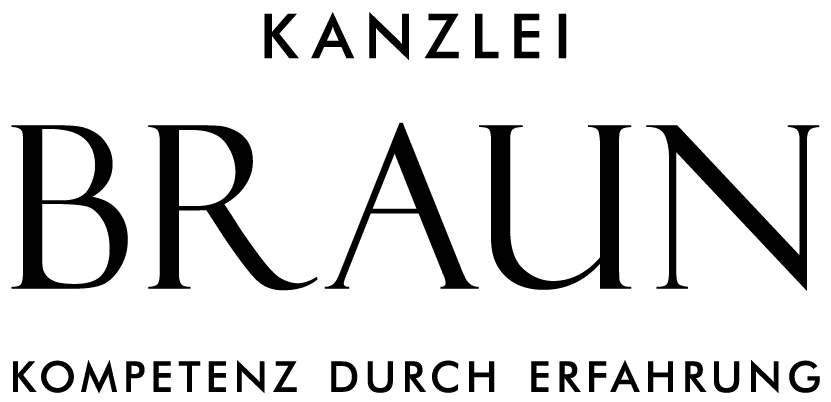Mit Urteil vom 28. Mai 2025 zum Aktenzeichen 18 SLa 959/24 hat das Landesarbeitsgericht Hamm ein deutliches Zeichen gegen ausufernde Videoüberwachung am Arbeitsplatz gesetzt. Der Fall zeigt exemplarisch, wie schmal der Grat zwischen berechtigten Sicherheitsinteressen eines Arbeitgebers und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten ist. Nach Auffassung des Gerichts stellt eine nahezu flächendeckende, permanente Kameraüberwachung über einen Zeitraum von 22 Monaten eine schwerwiegende Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar und rechtfertigt die Zuerkennung einer Geldentschädigung in Höhe von 15.000 Euro.
34 Kameras, 22 Monate – der Sachverhalt im Überblick
Gegenstand des Verfahrens war die Überwachung eines Produktionsmitarbeiters in einem Industriebetrieb, in dessen rund 15.000 Quadratmeter großer Betriebshalle insgesamt 34 Videokameras installiert waren. Die Kameras erfassten große Teile der Produktionsflächen, das Lager sowie Verkehrswege und zeichneten die Bilder rund um die Uhr mit einer Speicherdauer von mindestens 48 Stunden auf. Ein Live-Zugriff auf die Aufnahmen war jederzeit möglich. Zwar waren Pausen-, Umkleide- und Sanitärräume von der Überwachung ausgenommen, im Übrigen existierte jedoch kein Rückzugsort, in dem sich Beschäftigte der Beobachtung hätten entziehen können. Der Kläger hatte der Überwachung ausdrücklich widersprochen, dennoch führte die Arbeitgeberin das System unverändert fort.
Juristische Grundlagen der Entscheidung – klar und deutlich
Rechtlich stützte das Gericht den Anspruch auf Geldentschädigung auf mehrere Grundlagen. Zum einen verletzte die Arbeitgeberin ihre arbeitsvertraglichen Nebenpflichten nach §§ 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB, zum anderen lag ein deliktischer Eingriff in das durch § 823 Abs. 1 BGB geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht vor. Die Rechtsfolge ergab sich aus § 253 Abs. 2 BGB, der bei schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen eine Geldentschädigung zulässt, wenn der immaterielle Schaden nicht anders ausgeglichen werden kann. Einen Unterlassungsanspruch verneinte das Gericht hingegen, da das Arbeitsverhältnis bereits beendet war und es an einer Wiederholungsgefahr fehlte.
Datenschutzrechtlich ohne Rechtfertigung – DSGVO als Maßstab
Besonders deutlich fiel die datenschutzrechtliche Bewertung aus. Weder das Bundesdatenschutzgesetz noch die Datenschutz-Grundverordnung konnten die Überwachung rechtfertigen. Die Vorschriften zur Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume nach § 4 BDSG waren nicht anwendbar, da es sich bei der Produktionshalle um keinen öffentlich zugänglichen Bereich handelte. Auch § 26 Abs. 1 BDSG griff nicht: Zum einen genüge die Norm den unionsrechtlichen Anforderungen des Art. 88 DSGVO nicht, zum anderen fehlte es an dokumentierten tatsächlichen Anhaltspunkten für Straftaten, die eine derart intensive Überwachung hätten rechtfertigen können. Eine wirksame Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO lag ebenfalls nicht vor, da es an der Freiwilligkeit fehlte und die arbeitsvertragliche Klausel weder transparent noch mit einer Widerrufsbelehrung versehen war.
Strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung und psychischer Anpassungsdruck
Auch auf ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO konnte sich die Arbeitgeberin nicht berufen. Das Gericht unterzog die Überwachung einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung und kam zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme weder erforderlich noch angemessen war. Abstrakte Gefahren wie mögliche Diebstähle, Maschinenausfälle oder Aspekte der Arbeitssicherheit rechtfertigten keine dauerhafte Rundumüberwachung nahezu sämtlicher Arbeitsbereiche. Mildere Mittel – etwa die Überwachung von Außen- oder Zugangsbereichen – wären vorrangig gewesen. Hinzu kam, dass viele der vorgetragenen Gefahren weder konkretisiert noch belegt wurden.
Zentral für die Entscheidung war schließlich der psychische Effekt der Überwachung. Nach Auffassung des Gerichts erzeugt eine derart dichte und dauerhafte Kontrolle einen erheblichen Anpassungsdruck auf die Beschäftigten. Wer jederzeit damit rechnen muss, beobachtet zu werden – auch live –, passt sein Verhalten an und verliert einen wesentlichen Teil seiner Persönlichkeitsfreiheit. Dieser Druck bedürfe keiner weiteren Beweisführung; er ergebe sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung.
Erschwerend wertete die Kammer, dass die Arbeitgeberin die Überwachung trotz ausdrücklichen Widerspruchs des Klägers fortgeführt und erst verspätet eine Überarbeitung des Überwachungskonzepts in Aussicht gestellt hatte. Das Gericht ging daher von vorsätzlichem Handeln aus. Mit der zugesprochenen Entschädigung von 15.000 Euro bewegt sich das Urteil deutlich über bisherigen arbeitsgerichtlichen Entscheidungen zur Videoüberwachung. Zur Begründung verwies das Landesarbeitsgericht auf die außergewöhnliche Dauer und Intensität der Überwachung, den hohen Verschuldungsgrad der Arbeitgeberin sowie die allgemeine Geldentwertung. Im Vergleich zu früheren Fällen, in denen deutlich geringere Beträge zugesprochen worden waren, sei der Eingriff hier qualitativ wie quantitativ erheblich schwerer gewesen.
Klare Botschaft aus Hamm – Persönlichkeitsrechte enden nicht am Werkstor
Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm ist damit weit mehr als eine Einzelfallentscheidung. Es setzt klare Grenzen für den Einsatz technischer Überwachungsmittel im Betrieb und macht deutlich, dass permanente Kontrolle kein zulässiges Organisationsinstrument ist. Wer Beschäftigte über Monate hinweg nahezu lückenlos überwacht, riskiert nicht nur datenschutzrechtliche Beanstandungen, sondern empfindliche finanzielle Konsequenzen. Die Botschaft des Gerichts ist unmissverständlich: Sicherheit rechtfertigt keine Dauerbeobachtung – und Persönlichkeitsrechte enden nicht am Werkstor. Bei rechtlichen Fragen zur Zulässigkeit von Überwachungsmaßnahmen unterstützt Sie ein erfahrener Anwalt für Arbeitsrecht.