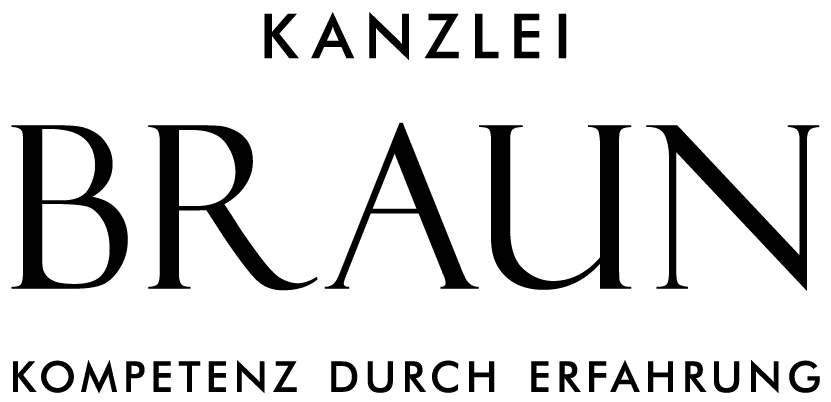Wenn Treuepflichten länger leben als Geschäftsführer
Ein Geschäftsführer gründete während seiner Amtszeit eine Konkurrenzfirma, schob Aufträge um und rechnete fremde Leistungen ab. Als all dies aufflog, war er längst draußen. Das OLG Brandenburg hat nun klargestellt: Eine Haftung bleibt auch dann bestehen, wenn man den Hut schon lange nicht mehr auf hat.
Im Fall, den das OLG Brandenburg mit Urteil vom 04.12.2024 zum Aktenzeichen 4 U 65/23 entschied, hatte ein Geschäftsführer eine zweite Gesellschaft mitgegründet, während er noch in Amt und Würden war. Er vermittelte Aufträge an das neue Unternehmen, rechnete über dieses ab – und ließ seine „alte“ Firma außen vor. Als er ging, waren nicht nur Projekte und Zahlungen umgeleitet, sondern auch viele Fragen offen. Die Klägerin, seine ehemalige GmbH, verlangte Auskunft – nicht nur über die offensichtlichen Geschäftsvorgänge, sondern auch über Absprachen, Treuhandverträge und verschwundene Auftragssummen. Das Gericht gab ihr weitgehend recht. Und erklärte nebenbei: Wer Geschäfte im Schatten macht, muss auch nach dem Abgang noch Licht ins Dunkel bringen.
OLG Brandenburg stärkt Auskunftspflichten
Der vorliegende Fall liest sich beinahe wie ein Lehrbuch über die Pflichten von Geschäftsführern – und ihre Grenzen. Juristisch ging es im Kern um die Auskunftspflicht des ehemaligen Geschäftsführers nach § 666 BGB i.V.m. §§ 675, 611 BGB. Das OLG betonte: Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden hinaus, sofern ein begründeter Verdacht auf Pflichtverletzung vorliegt – etwa durch Verstöße gegen das Wettbewerbsverbot oder die sogenannte Geschäftschancenlehre.
Die Vorwürfe gegen den Geschäftsführer waren massiv: Gründung einer Konkurrenzgesellschaft während der Amtszeit, Umleitung von Kundenaufträgen, Abrechnung über Dritte, obwohl die Leistungen von der Klägerin oder deren Partnerunternehmen erbracht wurden – und Zahlungen, die plötzlich an andere Konten flossen. Im Hintergrund: Treuhandverträge, Prokura, stille Beteiligungen.
Verletzung der Treuepflichten im Fokus
Die Klägerin war überzeugt, dass hier nicht nur die vertragliche Treuepflicht aus § 43 GmbHG, sondern auch das verbotene Ausnutzen interner Geschäftschancen verletzt worden sei. Und das Gericht folgte dieser Sicht.
Vertraglich geregelt war jedoch ein striktes Wettbewerbsverbot, das der Geschäftsführer missachtete – nicht nur durch Beteiligung an der Konkurrenzfirma, sondern auch durch faktisches Handeln für sie. Dass er formell nur Prokurist war, half ihm wenig: Das Gericht urteilte, dass auch diese Tätigkeit unter das Verbot falle. Entscheidend sei, dass beide Unternehmen „horizontal konkurrieren“, also dieselben Leistungen für denselben Markt anbieten. Dass die Klägerin als Generalplanerin tätig war, änderte daran nichts.
Geschäftschancenlehre als Kern des Urteils
Kernstück des Urteils bildet die Anwendung der sogenannten Geschäftschancenlehre, wie sie vom BGH (u. a. II ZR 159/10 und IX ZR 253/15) entwickelt wurde. Danach darf ein Geschäftsführer keine Gelegenheiten abziehen, die seiner Gesellschaft „bereits zugeordnet“ sind – also Projekte, über die verhandelt wurde oder für die Angebote vorliegen. Im konkreten Fall hatte die Klägerin nicht nur Honorarangebote erstellt, sondern war bei verschiedenen Projekten bereits eingebunden – etwa beim Projekt „01“, bei dem letztlich die Konkurrenzfirma abrechnete.
Das OLG stellte klar: Auch wenn ein Vertrag erst nach dem Ausscheiden des Geschäftsführers zustande kam, kann die Verantwortung noch aus der aktiven Zeit herrühren. Entscheidend sei, wann die Projektvergabe vorbereitet oder beeinflusst wurde.
Umfassende Offenlegung verlangt
Was das Gericht verlangte, war kein Alibi-Bericht, sondern eine tiefgehende Offenlegung. Der Geschäftsführer musste Auskunft geben über:
- alle angebahnten und geschlossenen Geschäfte der Konkurrenzfirma bis 29.01.2021
- alle Abreden, Beteiligungen, Treuhandverträge und Verteilungsschlüssel mit Mitgesellschaftern
- alle Zahlungen, die er selbst erhalten hat – einschließlich solcher, die als „Geschäftsführergehalt“ deklariert, waren
- alle Fälle, in denen Auftraggeber zur Konkurrenz umgeleitet wurden
- alle Dokumente, Mails, Verträge oder informellen Absprachen rund um zentrale Projekte
Der Beklagte hatte bereits Teile dieser Auskünfte gegeben – aber ohne Vollständigkeitserklärung nach § 362 BGB. Und genau das ist entscheidend, denn ein bisschen Offenheit reicht nicht. Wer einmal in der Pflicht steht, muss vollständig und nachprüfbar liefern – das ist der Maßstab des § 259 BGB, den das Gericht hier konsequent anlegte.
Gericht zieht klare Grenzen
Das Oberlandesgericht war bei aller Strenge aber nicht blind. Einige Punkte wies es ab, etwa die Forderung nach Auskunft über bloße Geschäftskontakte ohne Vertrag oder über Leistungen, bei denen der Schaden nicht bei der Klägerin, sondern bei einem verbundenen Partnerunternehmen lag. Auch dort, wo Informationen bereits vorlagen – z. B. durch zugängliche Vertragsunterlagen – verneinte das Gericht eine weitere Auskunftspflicht.
Gleichzeitig hielt das Gericht fest, dass die Klägerin nicht alles selbst rekonstruieren kann – insbesondere dann nicht, wenn der Geschäftsführer intern agiert und wesentliche Unterlagen oder Verbindungen nicht offenlegt. In solchen Fällen schützt § 666 BGB die Gesellschaft – nicht den ehemaligen Geschäftsführer.
Selbstbelastungsfreiheit greift nicht
Besonders bemerkenswert war die Feststellung, wonach das Gericht den Einwand zurückwies, dass der Geschäftsführer sich mit der Auskunft selbst belaste. Der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit nemo tenetur sei nicht berührt, weil das Zivilrecht nicht das Strafrecht sei – und im Strafverfahren ohnehin ein Verwertungsverbot für zwangsweise erlangte Auskünfte bestehe. Auch das BVerfG habe das so bestätigt -vgl. hier 1 BvR 116/77.
Das Urteil des OLG Brandenburg ist mehr als nur eine Pflichtlektüre für Geschäftsführer – es ist ein Weckruf an das Gewissen unternehmerischer Leitung. Wer sich in der GmbH-Spitze bewegt, trägt Verantwortung, die nicht mit der letzten Gehaltsabrechnung endet. Die §§ 666, 675, 611 BGB sind kein Verwaltungsakt, sondern ein mächtiges Werkzeug der Kontrolle, das Geschäftsführer auch nach ihrem Abgang zur Rechenschaft zieht.
Fazit: Haftung endet nicht mit dem Titel
Die GmbH ist keine Blackbox, aus der sich loyale Geschäftsführer bedienen können. Wer im Amt doppelt spielt, wird später zur Kasse – oder zumindest zur Offenlegung – gebeten. Die Geschäftschancenlehre lebt. Wer glaubt, parallel ein zweites Standbein auf Kosten der Gesellschaft bauen zu können, muss damit rechnen, auf beiden Beinen rechtlich einzuknicken. Wer sich hier unsicher ist, sollte rechtzeitig einen Anwalt für Gesellschaftsrecht einbeziehen, um Haftungsrisiken vorzubeugen.