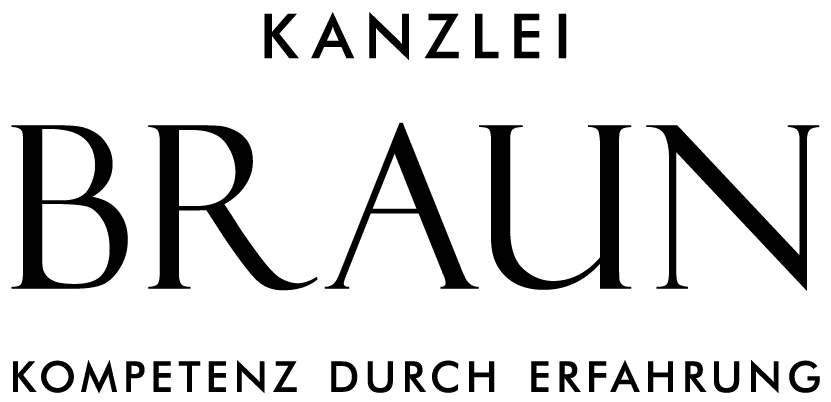BGH stärkt Rechte von Käufern bei verdeckten Mängeln.
Beim Kauf eines Pferdes spielt Vertrauen eine große Rolle. Doch was, wenn nach dem Kauf plötzlich gesundheitliche Probleme auftreten, die den Einsatz des Tieres einschränken? Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 29. März 2006 zu dem Aktenzeichen VIII ZR 173/05 hierzu wichtige Grundsätze aufgestellt. Im Zentrum des Rechtsstreits stand die Frage, ob ein Käufer auch dann Rechte geltend machen kann, wenn der Mangel – in diesem Fall eine Allergie – erst Monate nach der Übergabe sichtbar wird. Die Entscheidung stärkt den Verbraucherschutz beim Tierkauf und sorgt für mehr Klarheit im Pferderecht.
Ein Araberhengst und der Beginn eines Rechtsstreits
Der Fall begann mit dem Kauf eines fünf Jahre alten Araberhengstes. Die Verkäuferin, eine erfahrene Züchterin, veräußerte das Tier am 18. März 2002 für 7.100 Euro an den Kläger. Nur wenige Monate später, im August 2002, entwickelte das Pferd ein Sommerekzem, eine allergische Hauterkrankung, die durch Mückenstiche ausgelöst wird. Das Leiden äußerte sich in starkem Juckreiz und offenen Scheuerstellen an Mähne und Schweif. Für den Käufer war das Pferd dadurch nicht mehr für den ursprünglich geplanten Einsatz bei Distanzritten und als Reitpferd geeignet. Am 17. September 2002 erklärte er den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlangte die Rückabwicklung des Geschäfts sowie Ersatz für bereits entstandene Kosten.
Die Verkäuferin weigerte sich, den Kaufpreis zurückzuzahlen. Sie argumentierte, dass das Pferd bei Übergabe gesund gewesen sei und die Allergie erst später entstanden sein müsse. Der Käufer klagte daraufhin auf Rückzahlung des Kaufpreises und Ersatz von Aufwendungen. Während das Landgericht Arnsberg (4 O 396/02) die Klage zunächst abwies, gab das Oberlandesgericht Hamm (11 U 43/04) dem Käufer Recht. Es stützte sich auf § 476 BGB, der beim Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB) eine Beweislastumkehr vorsieht: Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe ein Mangel, wird gesetzlich vermutet, dass er schon beim Kauf vorhanden war. Für das OLG war daher klar, dass die Verkäuferin den Gegenbeweis hätte erbringen müssen – was ihr nicht gelang.
Verbraucherschutz gilt auch beim Pferdekauf
Die Verkäuferin legte Revision ein – mit Erfolg. Der BGH hob das Urteil des OLG auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück. Dabei stellte er zunächst klar, dass die Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs (§ 474 BGB) auch für Tierkäufe gelten. Wichtig sei lediglich, dass der Käufer als Verbraucher handelt und der Verkäufer als Unternehmer auftritt. Dass die Züchterin die Pferdezucht angeblich nur als Hobby ohne Gewinnerzielungsabsicht betreibe, spiele keine Rolle. Entscheidend sei das objektive Auftreten am Markt, nicht die persönliche Motivation.
Besonders bedeutsam war die Frage, ob die gesetzliche Vermutung des § 476 BGB auch bei Tieren greift. Der BGH bejahte dies grundsätzlich: Auch bei Pferden müsse der Verkäufer beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war, wenn er innerhalb von sechs Monaten sichtbar wird.
Klare Abgrenzung der Beweislast
Eine Ausnahme komme nur in Betracht, wenn die Art des Mangels eine solche Vermutung unplausibel mache – etwa bei Infektionskrankheiten, deren Ausbruch zeitlich nicht einzuordnen ist. Beim Sommerekzem sei dies jedoch nicht der Fall, weil Symptome wie Juckreiz und Hautveränderungen deutlich erkennbar seien und festgestellt werden könne, ob sie bereits vor dem Kauf aufgetreten waren.
Allerdings rügte der BGH die Beweiswürdigung des OLG. Die Vorinstanz habe sich zu sehr auf ein schriftliches Gutachten verlassen, das keine klaren Aussagen über den Zeitpunkt der Erkrankung zuließ. Dabei seien Zeugenaussagen unzureichend berücksichtigt worden, wonach das Pferd bis Herbst 2001 keinerlei Symptome gezeigt habe, obwohl es damals Mückenstichen ausgesetzt war. Dies könne ein starkes Indiz dafür sein, dass die Allergie erst nach dem Kauf entstanden sei. Der BGH betonte, dass der Verkäufer den vollen Beweis dafür erbringen müsse, dass der Mangel bei Übergabe nicht vorlag – nicht nur Zweifel säen. Gleichzeitig müsse der Käufer, wenn er behauptet, es habe bereits eine genetische Disposition oder ein verborgener Mangel bestanden, konkrete Anhaltspunkte dafür liefern.
Endgültige Entscheidung zugunsten des Käufers
Nach der Zurückverweisung durch den BGH (VIII ZR 173/05) entschied das OLG Hamm (11 U 43/04) erneut zugunsten des Käufers. Die Verkäuferin versuchte noch einmal, das Ergebnis durch eine weitere Revision anzufechten. Der BGH befasste sich daraufhin am 5. Februar 2008 unter dem Aktenzeichen VIII ZR 94/07 mit der Sache – diesmal in Form eines Beschlusses nach § 552a ZPO. Die Revision wurde endgültig zurückgewiesen.
Dabei stellte der BGH klar:
- die Allergie des Pferdes beruhte auf einer hochgradigen Sensibilisierung gegen Insekten, Pflanzen und Milben,
- diese Sensibilisierung wurde bereits am 11. September 2002 durch eine Laboruntersuchung vom 30. August 2002 diagnostiziert,
- die Diagnose fiel innerhalb der Sechsmonatsfrist des § 476 BGB,
- damit greift die gesetzliche Vermutung, dass der Mangel schon bei Gefahrübergang vorhanden war,
- der Verkäufer konnte diese Vermutung nicht widerlegen.
Somit wurde die Position des Käufers endgültig bestätigt, und die Verkäuferin musste den Kaufpreis zurückzahlen sowie die Kosten tragen.
Konsequenzen für Käufer und Verkäufer
Das zunächst ergangene BGH-Urteil hat weitreichende Folgen für den Pferdehandel. Zum einen wurde klargestellt, dass § 476 BGB und die Beweislastumkehr auch beim Pferdekauf gelten. Käufer sind damit besser geschützt, wenn innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe gesundheitliche Probleme auftreten. Zum anderen zeigte die Entscheidung, dass Gerichte genau prüfen müssen, ob die Krankheit tatsächlich schon beim Kauf vorlag oder erst später entstanden ist. Bei klar erkennbaren Symptomen wie beim Sommerekzem ist der Verkäufer in der Pflicht, das Gegenteil zu beweisen. Für Käufer bedeutet dies eine starke rechtliche Position – sie müssen nicht von vornherein nachweisen, dass das Pferd bei Übergabe krank war.
Für Verkäufer wiederum unterstreicht das BGH-Urteil die Notwendigkeit, den Gesundheitszustand ihrer Tiere sorgfältig zu dokumentieren und transparent zu kommunizieren. Wer Pferde verkauft, sollte eindeutige Untersuchungen durchführen lassen und diese schriftlich festhalten. Nur so lässt sich im Streitfall beweisen, dass ein Tier bei der Übergabe gesund war.
Der BGH hat mit seiner zweiten Entscheidung in konsequenter Fortführung seiner Rechtsprechung seine erste Entscheidung bestätigt und damit gestärkt. Seither ist klar, dass die Beweislastumkehr des § 476 BGB auch beim Pferdekauf uneingeschränkt gilt.
Wenn Sie rechtliche Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an einen erfahrenen Rechtsanwalt für Pferderecht.