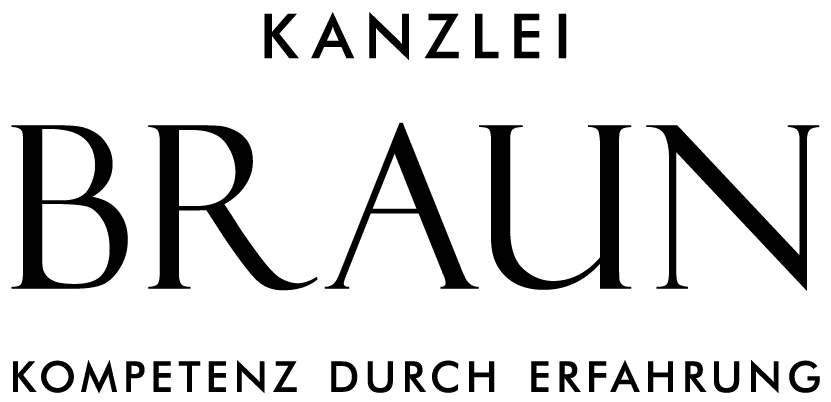Gericht stoppt taktische Kündigungen nach Betriebsübergang
„Recht ist Wille zur Gerechtigkeit.“ – Mit diesen Worten beschrieb Gustav Radbruch einst die Essenz des Rechts. Gerade in Zeiten tiefgreifender wirtschaftlicher Umbrüche zeigt sich jedoch, wie leicht dieser Wille ins Wanken geraten kann, wenn Unternehmen versuchen, bestehende Schutzmechanismen zu umgehen. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg hat nun in einem bemerkenswerten Urteil vom 25.07.2025 zum Aktenzeichen 12 La 640/25 klargestellt, dass der gesetzliche Kündigungsschutz nicht durch taktische Maßnahmen ausgehöhlt werden darf. Entscheidend sei nicht, wie viele Arbeitnehmer zufällig am Tag der Kündigung noch im Betrieb beschäftigt sind, sondern welche unternehmerische Planung der Arbeitgeber ursprünglich verfolgt hat.
Von der Verweigerung zum Restbetrieb
Der Fall begann mit einem Betriebsübergang zum 1. Juli 2023. Ein Unternehmen mit rund 49.000 Beschäftigten übertrug eine Geschäftseinheit auf eine andere Gesellschaft. Ein langjähriger Konstrukteur, seit 2004 im Unternehmen tätig, wollte den Wechsel nicht mitvollziehen. Wie 37 weitere Beschäftigte widersprach er dem Übergang nach § 613a BGB und wurde daraufhin einem sogenannten „Restbetrieb“ zugeordnet. Dieser hatte von Beginn an nur einen Zweck: die schrittweise Beendigung der Arbeitsverhältnisse der dort verbliebenen Mitarbeiter.
Bewerbungen, Kündigung und der Gang vors Gericht
In den Monaten nach dem Übergang versuchte der Kläger, innerhalb des Unternehmens eine neue Position zu finden. Zwischen August 2023 und Februar 2024 stellte er 41 interne Bewerbungen – alle blieben erfolglos. Im Februar 2024 erhielt er schließlich eine ordentliche Kündigung zum 31. August 2024. Zu diesem Zeitpunkt waren im Restbetrieb nur noch fünf Personen beschäftigt. Die Arbeitgeberin argumentierte nun, dass der Betrieb damit unter die Schwelle des Kündigungsschutzgesetzes falle. Bei so wenigen Beschäftigten, so die Begründung, greife der gesetzliche Kündigungsschutz nicht mehr.
Der Kläger wollte diese Sichtweise nicht akzeptieren. Für ihn war klar: Maßgeblich sei der Zeitpunkt im Juli 2023, als der Restbetrieb gegründet wurde. Damals arbeiteten dort noch mehr als zehn Personen, womit der Schwellenwert des § 23 Abs. 1 KSchG überschritten war. Das Arbeitsgericht folgte zunächst der Argumentation der Arbeitgeberin und wies die Klage ab. Doch das LAG Berlin-Brandenburg entschied in der Berufung zugunsten des Klägers und erklärte die Kündigung für sozial ungerechtfertigt und damit unwirksam nach § 1 Abs. 1 KSchG.
Gericht rügt Trickserei: Die wahre Betriebsgröße zählt
Das Gericht stellte klar, dass für die Bestimmung der Betriebsgröße nicht allein die tatsächliche Zahl der Beschäftigten am Tag der Kündigung entscheidend sei. Wenn ein Personalabbau auf einer einheitlichen und von Beginn an geplanten Strategie beruhe, sei die ursprüngliche unternehmerische Entscheidung der maßgebliche Zeitpunkt.
Mit anderen Worten: Unternehmen können nicht durch ein zeitliches „Heraustakten“ von Kündigungen den Schutz der Mitarbeiter umgehen. Auch wenn der Abbau in mehreren Stufen erfolgt, bleibt entscheidend:
- die Belegschaftsstärke zum Zeitpunkt der Gründung des Restbetriebs,
- oder alternativ: der Beginn der unternehmerischen Abbauplanung.
Signalwirkung für Betriebsräte und Arbeitnehmer
Diese Auslegung dient dem Zweck, Missbrauch zu verhindern. Würde man nur auf den Kündigungstag abstellen, könnte ein Arbeitgeber zunächst einen Teil der Belegschaft entlassen oder auf andere Weise reduzieren, um dann den verbliebenen Rest ohne Kündigungsschutz abzubauen. Das LAG macht deutlich, dass ein solcher formaler Trick nicht im Einklang mit dem Sinn und Zweck des KSchG steht.
Für Arbeitnehmer und Betriebsräte hat das Urteil erhebliche Bedeutung. Es stärkt ihre Position in Situationen, in denen nach einem Betriebsübergang Kündigungen ausgesprochen werden. Wer sich gegen eine Entlassung wehren möchte, sollte genau prüfen, ob der Personalabbau Teil eines einheitlichen Plans ist, der von Anfang an auf die Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse gerichtet war.
Kündigungsschutz bleibt Schutz – auch in stürmischen Zeiten
Die Entscheidung zeigt, dass das Kündigungsschutzgesetz mehr ist als ein bürokratisches Regelwerk. Es schützt vor Willkür und wahrt die Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und sozialer Verantwortung. Oder, um Radbruch noch einmal zu zitieren: Wo der Wille zur Gerechtigkeit sich im Recht zeigt, darf er nicht durch taktisches Kalkül ersetzt werden. Dieses Urteil erinnert daran, dass das Recht nur dann seine Wirkung entfalten kann, wenn es den Menschen in den Mittelpunkt stellt – auch in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche und schmerzhafter Entscheidungen.
Wer sich in ähnlicher Lage befindet, sollte nicht zögern, sich frühzeitig an einen erfahrenen Anwalt für Arbeitsrecht zu wenden.